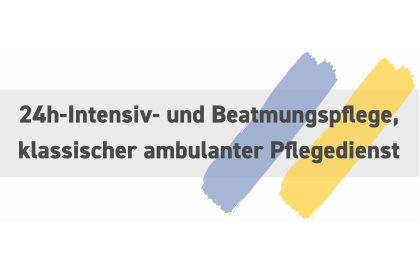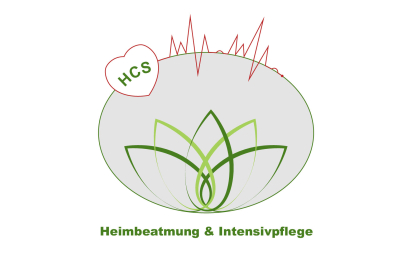Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine progressive neurodegenerative (fortschreitender Verlust von Nervenzellen) Erkrankung, die zunächst einen Teilbereich und schließlich die gesamte Muskulatur des Körpers betrifft. Der Krankheitsbeginn setzt zumeist schleichend ein und kann sehr unterschiedliche Symptome aufweisen. So können gelegentliches Stolpern, zurückführend auf Paresen (Lähmungen) der Beine und Füße, als auch gelegentliche Lähmungserscheinungen in den Armen (Halten von Gegenständen) Zeichen für den Erkrankungsbeginn sein. Ebenso können Sprach- oder Schluckstörungen (bulbäre Störungen) Hinweise geben, wobei diese Beeinträchtigungen in der Frühphase der Erkrankung seltener vorkommen.
Gleichsam undifferenziert ist der Verlauf, so dass keine Prognosen gegeben werden können. Bei fortschreitender Erkrankung kommen teilweise schmerzlose Paresen und spastische Symptome (Erhöhung der Muskelspannung) hinzu, wohingegen Augenmuskeln, Schließmuskeln von Darm und Blase sowie der Herzmuskel nicht betroffen werden. Zu den häufigsten Symptomen gehören Dysarthrie (Sprachstörungen) und Dysphagie (Schluckstörungen) sowie Laryngospasmen (Verkrampfungen der Kehlkopfmuskulatur), welche dann die Atemtätigkeit beeinträchtigen. Ferner kann sich die Lähmung in der Atemmuskulatur selbst manifestieren.
Statistisch gesehen beträgt die Überlebenszeit nach Diagnosestellung drei Jahre. Bei ca. 10% der Erkrankten verlängert sich die Zeit auf mehr als fünf Jahre und ca. 5% leben noch zehn Jahre und länger.Therapieansätze
Die Therapie kann im Frühstadium mit einer medikamentösen Behandlung einsetzen, zielführend ist das Fortschreiten der Erkrankung zu verzögern; heilende Therapien gibt es derzeit nicht. Daher steht die symptomatische Behandlung unter frühzeitiger Nutzung geeigneter Hilfsmittel im Fokus, um die Lebensqualität so gut und lange als möglich aufrecht zu erhalten. Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden leisten einen wichtigen Beitrag, Komplikationen vorzubeugen und Verschlimmerungen hinauszuzögern. Physiotherapie zielt u.a. auf eine Kontrakturprophylaxe und der Vermeidung von Spastiken ab. Mittels ergotherapeutischer Interventionen soll insbesondere die Handfunktion aufrechterhalten werden. Logopädische Therapien bewahren die Sprachfunktion und orientieren sich an den Ressourcen der Erkrankten. Zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität spielen sowohl Ernährung als auch Atemfunktion eine übergeordnete Rolle.
Ernährungssituation im Krankheitsverlauf
Gewichtsabnahmen sind häufige Folgen im Krankheitsverlauf, welche bei ca. 30% der Erkrankten auf Dysphagie (Schluckstörungen) zurückzuführen sind. Diese führt zu einer Reihe weiterer Komplikationen wie: Mangel- und Unterernährung, Dehydration, Aspiration mit nachfolgender Pneumonie, aber auch Abneigung gegen Essen und Trinken. Gewichtsabnahmen von mehr als 10% des Ausgangsgewichtes innerhalb der letzten drei Monate erfordern sofortiges Handeln und enges Monitoring (Salvioni 2014:157-163). Die anfängliche Behandlung von Schluckstörungen basiert auf Änderungen der Konsistenz, Viskosität, Temperatur und Anrichten der Speisen. Bewährt haben sich angedickte Speisen (z.B. Thick and Easy) und Getränke, um ein Verschlucken zu reduzieren. Zunächst können Supplemente in Form von hochkalorischer und eiweißreicher (1,0-1,2g Eiweiß/kg Körpergewicht) Trinknahrung eingesetzt und somit einer Mangel- sowie Unterernährung vorgebeugt werden als diese auch den Muskelabbau verzögern. Im Handel sind mittlerweile auch hochkalorische Supplemente in puddingartiger Konsistenz. Können genannte Komplikationen nicht mehr vermieden werden sollte frühzeitig über eine PEG-Anlage (Perkutan Endoskpoische Gastrostomie) zur enteralen Ernährung nachgedacht werden.
In einer aktuellen, jedoch klein angelegten Pilotstudie in Boston wurden die Auswirkungen auf die Gewichtszunahme in Abhängigkeit von erhöhter Kalorienzufuhr untersucht. Die Studienteilnehmer wurden auf drei Gruppen verteilt, die Kontrollgruppe erhielt so viele Kalorien, dass das Gewicht gehalten werden sollte. Zwei Gruppen erhielten 25% mehr Kalorien als die Kontrollgruppe. Eine Gruppe erhielt die Kalorien über einen höheren Kohlenhydratanteil und die andere Gruppe über eine erhöhte Zufuhr von Fett. Dabei wurde festgestellt, dass Patienten durch eine kohlenhydratreiche Nahrung etwa dreimal soviel Gewicht zunahmen (ca. 390 Gramm pro Monat) wie Patienten mit normaler Ernährung (ca.110 Gramm pro Monat). Dahingegen führte fettreiche Ernährung zu einem Gewichtsverlust von ca. 460 Gramm pro Monat. (Wills 2014). Wegen geringer Studiengröße müssen weitere Untersuchungen in diesem Bereich folgen. Auch in der Studie von Salvioni et al. wird eine Erhöhung der täglichen Kalorienzufuhr (Erhöhung um 30% gegenüber der normokalorischen Ernährung) empfohlen.
Ist eine PEG unumgänglich, kann mit einer bedarfsdeckend bilanzierten Sondennahrung einer Verschlechterung des Ernährungszustandes Einhalt geboten und der Nährstoffbedarf gedeckt werden. Eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2012 zeigt, dass die Anlage einer PEJ (Perkutan Endoskopische Jejunostomie) weniger Komplikationen im Hinblick auf Aspiration mit nachfolgender Pneumonie bietet. Während der Verabreichung bzw. bis eine Stunde nach letzter Nahrungsgabe muss das Kopfteil des Bettes mindestens auf 30O erhöht werden, um Reflux und damit verbundene Aspiration der Nahrung zu vermeiden. Die Ernährung über eine PEG sollte nicht als Ersatztherapie, sondern zunächst als ergänzende Therapie gesehen und, sofern eine orale Nahrungsaufnahme möglich ist, sollte diese auch bevorzugt werden. Durchfälle, als häufigste Komplikation der enteralen Ernährungstherapie, können durch Anpassung (Reduktion) der Applikationsgeschwindigkeit und durch Zufuhr einer ausreichenden Menge an Ballaststoffen in der Regel umgangen werden.
Atemfunktion erhalten
„Die ALS führt als chronisch fortschreitende Erkrankung bei den meisten Patienten im Verlauf zu Atemproblemen. Diese werden durch den Befall von 3 verschiedenen Muskelgruppen verursacht: Einatemmuskulatur, Ausatemmuskulatur und die Muskulatur des Rachen-/Kehlkopfbereichs (bulbäre Muskulatur).“ (Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V.). Die progrediente Schwäche führt zunehmend zu Minderbelüftung der Lunge mit daraus resultierender Müdigkeit. Eine weitere Folge ist die Abschwächung des Hustenstoßes. Dadurch droht die Ansammlung von Sekret mit teilweisem Verschluss der Bronchien (Atelektasen) und einer erhöhten Infektionsgefahr (Keimbesiedelung). Die regelmäßige Überprüfung der Lungenfunktion (z.B. Spirometrie) soll frühzeitig auf Funktionseinschränkungen hinweisen, um entsprechende Therapien einzuleiten. Zur Aufrechterhaltung der Atemfunktion kann eine NIV-Therapie (Nicht Invasive Ventilation), d.h. eine Beatmung mittels einer Atemmaske als unterstützende Maßnahme geeignet sein. Reicht diese Maßnahme nicht aus, sollte frühzeitig über eine Tracheotomie (Luftröhrenschnitt) mit anschließender maschineller Beatmung nachgedacht und diese zuvor mit dem Patienten besprochen werden. Für ein erfolgreiches Sekret-Management können verschiedene Therapien eingesetzt werden. Regelmäßige Inhalationen und Vibrationsmassagen sind zur Sekretolyse (Schleimlösung) erfolgreiche Maßnahmen, aber auch die Mitbehandlung durch Physiotherapeuten, z.B. zur manuellen Unterstützung beim Abhusten, wird als ergänzende Therapie empfohlen. Reichen diese Maßnahmen nicht mehr aus, kann auf weitere Hilfen, wie beispielsweise den „Cough Assist“ zurückgegriffen werden. Dieses Gerät baut in der Lunge während der Einatmung einen Überdruck und einen Unterdruck (Sog) während der Ausatmung auf, wodurch das Sekret nach außen befördert wird. (Miller 2009: 1218-1226).
Quellen:
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MUSKELKRANKE e.V. (DGM), Geiseler J., Amyotrophe Lateralsklerose (ALS): Atemtherapie
Zugriff: 02.07.2014
MILLER, Robert G., et al. Practice Parameter update: The care of the patient with amyotrophic lateral sclerosis: Drug, nutritional, and respiratory therapies (an evidence-based review) Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology, 2009, 73. Jg., Nr. 15, S. 1218-1226. Available from:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2764727/pdf/6980.pdf
SALVIONI, Cristina Cleide dos Santos; STANICH, Patricia; ALMEIDA, Claudinéa S. and OLIVEIRA, Acary Souza Bulle. Nutritional care in motor neurone disease/ amyotrophic lateral sclerosis. Arq. Neuro-Psiquiatr. [online]. 2014, vol.72, n.2 [cited 2014-07-02], pp. 157-163 . Available from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2014000200157&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0004-282X. Zugriff: 02.07.2014