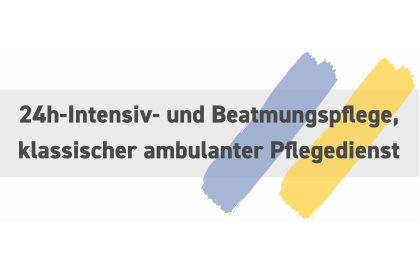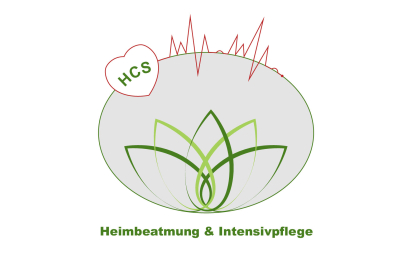Den Ausschlag für die Gründung des Bergmannsheil bildeten die steigenden Unfallzahlen im Ruhrbergbau: In seiner Hochphase entstanden immer mehr und größere Zechenbetriebe, in denen in immer größerer Tiefe das „schwarze Gold“ abgebaut und zutage gefördert wurde. Dies erhöhte zugleich die Gefahren, denen der Bergmann an seinem Arbeitsplatz ausgesetzt war. Grubenunglücke durch Gasexplosionen oder unzureichend gesicherte Abbaubetriebe gingen immer wieder einher mit vielen Toten und Verletzten. Zugleich litten die Bergleute zunehmend an arbeitsplatzbedingten Erkrankungen wie Arthrose, Rheuma, Asthma oder Steinstaublunge (Silikose).
„Röntgen-Cabinet“ und „Medico-mechanisches Institut“
Das Bergmannsheil sollte fortan aufgrund seiner Spezialisierung und seiner besonderen Ausstattung ein bestmögliches, umfassendes und effizientes Behandlungsangebot für diese Patientengruppen sicherstellen. Bei seiner Errichtung wurden neueste Erkenntnisse des Krankenhausbaus und der Hygiene berücksichtigt. Zugleich wurden hier viele Innovationen etabliert, die zu jener Zeit keineswegs als selbstverständlich für ein Krankenhaus galten. Damit Unfallverletzte beispielsweise möglichst schnell in die Klinik befördert und dort versorgt werden konnten, wurde von Anbeginn ein Krankentransportwagen vorgehalten – anfangs noch von Pferden gezogen, später dann motorisiert. 1892 eröffnete die Klinik ein sogenanntes „Medico-mechanisches Institut“, das die Nachbehandlung und Rehabilitation von verunfallten Patienten zu verbessern half. Die Patienten arbeiteten hier an Übungsmaschinen, um Kraft aufzubauen und Muskeln zu trainieren – so, wie man es heute aus modernen Rehabilitationseinrichtungen und Fitness-Studios kennt. 1896 folgte die Einrichtung eines „Röntgen-Cabinets“: Das Bergmannsheil war somit eines der ersten Krankenhäuser, das diese neue diagnostische Methode im klinischen Alltag anwandte. Denn erst wenige Monate zuvor, im November 1895, waren die „unsichtbaren Strahlen“ von Wilhelm Conrad Röntgen entdeckt worden.
In kürzester Zeit etablierte sich die neue Spezialklinik in der medizinischen Versorgungsstruktur des Ruhrgebietes, die mit ihren therapeutischen Erfolgen von sich reden machte. Die Nachfrage nach Behandlungsplätzen überstieg schon in der Anfangszeit deutlich das verfügbare Angebot. Denn neben verunfallten Bergleuten wurden auch Patienten anderer Versicherungsträger und aus der Bochumer Bevölkerung versorgt. Neue Gebäude wurden errichtet, um weitere Stationen und Funktionsabteilungen aufnehmen zu können. War das Krankenhaus in seiner Gründungsphase noch für lediglich maximal 100 Patienten ausgelegt, so gab es vor Beginn des ersten Weltkriegs bereits 350 Betten.
Behandlung von Soldaten und Kriegsverletzten
Während und nach dem ersten Weltkrieg veränderte sich auch das Aufgabenspektrum des Bergmannsheil, das in hohem Maße verwundete Soldaten und Kriegsverletzte behandelte. Seit 1918 wurden Prothesen für amputierte Patienten in einer eigenen orthopädischen Werkstatt hergestellt. In den 1920er und 1930er Jahren erweiterte die Klinik ihr Spektrum. Dies äußerte sich im Aufbau einer Prosektur und insbesondere in der Gründung einer eigenen Inneren und Neurologischen Klinik: Zu einem ihrer Schwerpunkte wurde die Diagnostik und Erforschung der unter Bergleuten verbreiteten Silikose und weiterer Erkrankungen, die auf die Arbeit unter Tage zurück zu führen waren. Die Anerkennung der Silikose als Berufskrankheit im Jahre 1929 sorgte für eine nochmalige Erweiterung dieses Aufgabengebietes innerhalb der Inneren Abteilung. Mit dem Auf- und Ausbau des Leistungsangebotes wurden auch bauliche Um- und Neubauten erforderlich. Anfang der 1930er Jahre verfügte die Bochumer Klinik bereits über 470 Betten. Weil auch diese Kapazitäten nicht ausreichten, entstand zwischen 1927 und 1929 in Gelsenkirchen-Buer ein zweites Bergmannsheil mit 250 Betten. Zur Deckung des steigenden Personalbedarfs baute das Bergmannsheil in Bochum eine eigene Krankenpflegeschule und eine Massageschule auf. Außerdem wurde eine Hausapotheke eingerichtet.
Kriegszerstörung und Wiederaufbau
Im Zweiten Weltkrieg lief der Klinikbetrieb zunächst weitgehend ungestört weiter, bis 1943 dann die ersten Bomben das Krankenhaus trafen. Maßnahmen zur Verlegung des Krankenhausbetriebs nach unter Tage wurden zwar begonnen, aber nicht mehr umgesetzt. 1944 wurde das Krankenhaus durch Bombeneingriffe weitgehend zerstört. Der Betrieb wurde auf mehrere Ausweichquartiere verlagert. Nach Kriegsende dauerte es noch einige Zeit, bis die Entscheidung zum Wiederaufbau des Bergmannsheil an seinem angestammten Platz gefallen war. Ab 1949 wurden sukzessive die neuen Gebäude fertig gestellt und in Betrieb genommen. Neben den Gebäuden für die Chirurgische, die Innere Klinik und die Verwaltung sind als Besonderheiten der Bau eines der ersten klinikeigenen Hallenbades und eines Hörsaals zu nennen. Wichtige Neuerungen waren der Aufbau einer Abteilung für Querschnittgelähmte (1952) und einer Abteilung für Schwerbrandverletzte (1964). Auch gewannen die Disziplinen der Inneren Medizin zunehmend an Bedeutung, differenzierten sich und entwickelten sich zu eigenständigen Abteilungen und Kliniken. 1958 wurde eine eigene neurologische Fachabteilung begründet, die vier Jahre später zur Neurologischen Klinik wurde. Auch die Anästhesiologie wurde seit 1965 als eigenständige Klinik geführt. Diese Entwicklung ging einher mit der Veränderung des Patientenklientels des Bergmannsheil und seiner Entwicklung von einem Spezialkrankenhaus zu einem Allgemeinkrankenhaus mit Maximalversorgungsstatus. Den Hintergrund bildeten Bergbaukrise und Zechensterben: Denn mit den Beschäftigtenzahlen im Bergbau sanken auch die Arbeitsunfälle kontinuierlich. Eine große Rolle spielten dabei jedoch auch die stetig verbesserten Maßnahmen zur Unfallprävention und zum Arbeitsschutz der Berufsgenossenschaften. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung öffnete sich die Klinik verstärkt für andere Patientengruppen.
Das Bergmannsheil als Universitätsklinik
1977 wurde das Bergmannsheil zur Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum, gemeinsam mit weiteren Kliniken aus dem Bochumer Raum. Dieses anfangs als Provisorium gestartete „Bochumer Modell“, das anstelle einer ursprünglich geplanten Campus-Klinik die Medizinerausbildung für die Medizinische Fakultät der Ruhr-Universität sicherstellte, erwies sich in der Praxis als überaus erfolgreich. Da zudem dem Land Nordrhein-Westfalen die Mittel fehlten, das Projekt Campus-Klinik in Bochum wahr werden zu lassen, wurde die bestehende Kooperation mit den Bochumer Krankenhäusern schließlich als dauerhafte Lösung etabliert. Für das Bergmannsheil ein Glücksfall: Durch die Anbindung an die Medizinische Fakultät konnte das Bergmannsheil auch seine vielfältigen Aktivitäten in Wissenschaft und Forschung nun in einem universitären Kontext fortführen und intensivieren. Zudem war und ist die Medizinerausbildung für die Ruhr-Universität auch in Hinblick auf die Gewinnung von qualifiziertem, ärztlichen Nachwuchs bis heute ein erheblicher Vorteil. Die neue Struktur machte eine erneute Ausweitung des medizinischen Leistungsangebotes erforderlich. 1977 entstand die Abteilung für Radiologie und Nuklearmedizin; im folgenden Jahr entstanden Abteilungen für Kardiologie und Gastroenterologie. Auch baulich wurde eine neue Modernisierungsphase eingeleitet: 1984 wurde der neue zentrale Funktionstrakt eröffnet, zwei Jahre später folgte das neue Haus 1 und 1989 ging das Rehabilitationszentrum mit dem angegliederten Verwaltungstrakt in Betrieb. Eigene Abteilungen für Endokrinologie, Schwer-Schädel-Hirnverletzte und für Pneumologie setzten den Trend zur weiteren Differenzierung des medizinischen Spektrums fort.
Neuer baulicher Masterplan
In den folgenden Jahren veränderte sich das Leistungsprofil vor allem durch den Aufbau der Herzchirurgie, die 1992 in einem neu errichteten Gebäude ihre Arbeit aufnahm. Innerhalb der anästhesiologischen Klinik wurden spezialisierte Abteilungen für Schmerzmedizin und Palliativmedizin geschaffen. In jüngster Zeit ist die Gründung einer Abteilung für BG Neurochirurgie und Neurotraumatologie zu nennen. Weiterhin wurde eine neue bauliche Zielplanung entwickelt, die den Abriss und Neubau der beiden alten Bettenhäuser aus den 1950er Jahren sowie die Schaffung eines neuen zentralen Funktionstraktes vorsah. 2007 ging bereits das neue Bettenhaus 3 in Betrieb, das mit seinem doppelten Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach bis heute das weithin sichtbare Erkennungssymbol der Klinik ist. 2013 folgte die Eröffnung des ersten Bauabschnittes vom neuen Bettenhaus 2 und vom neuen Funktionstrakt mit Notaufnahme, OP-Zentrum und Radiologie. In den kommenden drei Jahren werden beide Gebäudeteile jeweils um die gleichen Ausmaße erweitert.
Über 80.000 Patienten pro Jahr
Durch bauliche und organisatorische Modernisierungen sollen auch in Zukunft das Leistungsprofil des Bergmannsheil gestärkt und ausgebaut werden. 23 Kliniken und Fachabteilungen arbeiten heute unter dem Dach des Krankenhauses, das als Notfallklinikum und überregionales Traumazentrum weit über die Grenzen des Ruhgebietes hinaus bekannt ist. Über 80.000 Patienten werden pro Jahr hier behandelt. Mit eigenen Forschungseinrichtungen und Laboren ist das Bergmannsheil auch ein Impulsgeber der medizinischen Forschung auf nationaler und internationaler Ebene und es ist Ausbilder für Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten. Dank seiner besonderen Struktur als berufsgenossenschaftliches und universitäres Krankenhaus behandelt das Bergmannsheil alle Patienten unabhängig von deren Versichertenstatus. Und zwar gemäß seines leitenden Motivs: „Heilen und helfen mit allen geeigneten Mitteln“.
Eine ausführliche Darstellung zur Geschichte des Bergmannsheil bietet die aktuelle Darstellung von Dietmar Bleidick, 125 Jahre Bergmannsheil. Hrsg. vom Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikum.
Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil GmbH
Bürkle-de-la-Camp-Platz 1
44789 Bochum
Telefon 0234 · 302-6125
www.k-uv.de