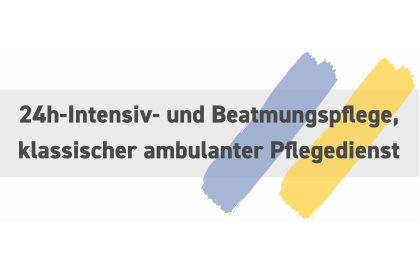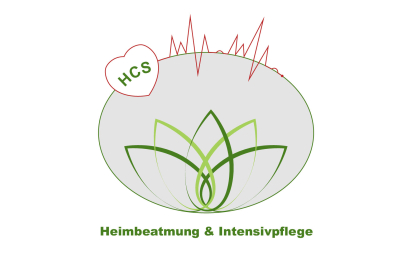Was bedeutet nun diese Entscheidung für Patienten, die sich mit dem Gedanken tragen, eine Patientenverfügung zu erstellen? Was bedeutet sie für Patienten, die bereits eine Patientenverfügung erstellt haben?
Grundsätzlich stellen sämtliche ärztliche Behandlungen eine strafbare Körperverletzung dar, sofern die Ärzte nicht mit Einwilligung der Patienten handeln. Ausnahmen bilden lediglich die ärztlichen Maßnahmen, die keinen Aufschub dulden, weil sich die Patienten in einer lebensbedrohlichen Situation befinden. Hierbei ist die Entscheidung des Arztes nach dem sogenannten mutmaßlichen Willen des Patienten vorzunehmen, wobei der Arzt davon ausgehen darf, dass ein Patient, der sich in Lebensgefahr befindet, den mutmaßlichen Willen hat, behandelt zu werden.
Für alle anderen medizinischen Behandlungssituationen ist eine Einwilligung zur Behandlung erforderlich. Ist der Patient selbst nicht mehr in der Lage, eine solche Einwilligung zu erteilen (z. B. aufgrund Zustand im Wachkoma mit Beatmungspflicht oder Zustand bei fortgeschrittener Demenz), kann stellvertretend die Einwilligung erteilt werden, sofern ein Dritter dazu berechtigt ist. Eine solche Berechtigung ergibt sich jedoch nicht schon aufgrund eines nahen Verwandtschaftsverhältnisses, sondern erst durch die Erteilung einer Vollmacht seitens des Patienten an den Angehörigen oder einen anderen Dritten (Vorsorgevollmacht oder Generalvollmacht) oder die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung durch das Betreuungsgericht.
Sowohl den Bevollmächtigten als auch den rechtlichen Betreuern müssen jedoch, um Entscheidungen im Bereich der medizinischen Versorgung und besonders Entscheidungen am Lebensende stellvertretend treffen zu dürfen, ausdrücklich der Aufgabenkreis Gesundheitsfürsorge übertragen werden. Sollen Bevollmächtigte oder Betreuer auch Entscheidungen treffen dürfen, mit denen sie ggf. auch Behandlungsmaßnahmen in der letzten Lebensphase beenden oder die Einwilligung in lebensverlängernde Maßnahmen verweigern, muss zusätzlich ein Verweis auf § 1904 BGB erfolgen, der inhaltlich auf die dort genannten Maßnahmen ausreichend klar Bezug nimmt. Aus dem Sinn des Gesetzes, dem Patienten die Tragweite einer solchen Bevollmächtigung vor Augen zu führen, folgt zwar nicht, dass in der Vollmacht der genaue Wortlaut des § 1904 BGB wiedergegeben werden muss.
Nicht ausreichend ist jedoch allein der Verweis auf die gesetzliche Bestimmung, weil eine solcher keine ausdrückliche Nennung der Maßnahmen beinhaltet und der Schutz des Vollmachtgebers/Patienten nicht erreicht würde. Der Vollmachttext muss vielmehr hinreichend klar umschreiben, dass sich die Entscheidungskompetenz des Bevollmächtigten auf die im Gesetz genannten ärztlichen Maßnahmen sowie darauf bezieht, diese zu unterlassen oder am Patienten vornehmen zu lassen. Hierzu muss aus der Vollmacht auch deutlich werden, dass die jeweilige Entscheidung mit der begründeten Gefahr des Todes des Patienten oder eines schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schadens verbunden sein kann.
Die Praxis zeigt, dass jedoch nicht nur nahe Angehörige von Patienten zu Bevollmächtigten oder rechtlichen Betreuern bestellt werden, sondern auch fremde Dritte, die die Patienten möglicherweise erst im Zustande der Einwilligungsunfähigkeit kennenlernen und insofern nicht wissen, wie die Patienten in der letzten Lebensphase sich in Bezug auf lebensverlängernde Maßnahmen entscheiden würden. Hilfreich ist hier eine Patientenverfügung, die nicht nur konkrete Weisungen an die behandelnden Ärzte für den Fall der Einwilligungsunfähigkeit des Patienten beinhalten, sondern auch dem Bevollmächtigten oder rechtlichen Betreuer wertvolle Hinweise dafür geben, wie sie stellvertretend entscheiden sollen.
Der Gesetzgeber hat mit den Regelungen in §§ 1901a und b, 1904 BGB das Ziel verfolgt, den betroffenen Patienten eine vorsorgende privatautonome Entscheidung der Fragen zu ermöglichen, die sich im Zusammenhang mit ärztlichen Maßnahmen zu einem Zeitpunkt stellen können, in dem die Patienten zu einer eigenen rechtlich wirksamen Entscheidung nicht mehr in der Lage sind. Hierfür ist die Patientenverfügung vorgesehen.
Unmittelbare Bindungswirkung entfaltet eine Patientenverfügung jedoch nur dann, wenn ihr konkrete Entscheidungen des Patienten über die Einwilligung oder Nichteinwilligung in bestimmte, noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahmen entnommen werden können. Nicht ausreichend sind, insbesondere nach der aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofes, allgemeine Anweisungen, wie die Aufforderung, ein würdevolles Sterben zu ermöglichen oder zuzulassen, wenn ein Therapieerfolg nicht mehr zu erwarten ist. Anforderungen an solch bestimmte Formulierungen dürfen jedoch nicht überspannt werden. Vorausgesetzt werden kann nur, dass die Betroffenen umschreibend festlegen, was sie in einer bestimmten Lebens- und Behandlungssituation wollen oder was sie nicht wollen. Maßgeblich ist natürlich nicht, dass die Betroffenen ihre eigene Biographie als Patienten vorausahnen und die zukünftigen Fortschritte in der Medizin vorwegnehmend berücksichtigen. Eine solche erforderliche konkrete Beschreibung dessen, was die Patienten wünschen oder nicht wünschen, kann aber ggf. durch die Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen (z. B. künstliche Ernährung oder künstliche Beatmung) oder die Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen (z. B. Zustand nach Wachkoma, Demenz etc.) erfolgen.
Bevollmächtigte und Betreuer müssen bei Existenz einer solchen Patientenverfügung prüfen, ob diese Verfügung auf die aktuell eingetretene Lebens- und Behandlungssituation zutrifft. In diesem Zusammenhang soll der Bevollmächtigte/Betreuer auch prüfen, ob die Entscheidung noch dem Willen des Betroffenen entspricht, also das aktuelle Verhalten des Betroffenen konkrete Anhaltspunkte dafür liefert, dass er unter den gegebenen Umständen nicht mehr an dem zuvor schriftlich geäußerten Willen festhalten möchte. Die Entscheidung ist mit dem behandelnden Arzt zu erörtern, hierbei haben grundsätzlich nahe Angehörige und sonstige Vertrauenspersonen die Möglichkeit, sich ebenfalls zu äußern, sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. Liegt eine solche wirksame und auf die aktuelle Situation zutreffende Verfügung vor, obliegt es dem Betreuer/Bevollmächtigten, diesem Willen Ausdruck und Geltung zu verschaffen.
Insoweit trägt die Entscheidung des Bundesgerichthofes zu einer weiteren Konkretisierung der Anforderungen an eine wirksame Patientenverfügung bei, ohne diese Anforderungen für die Patienten zu überspannen oder gar unmöglich zu machen.
Bärbel Schönhof
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Sozialrecht