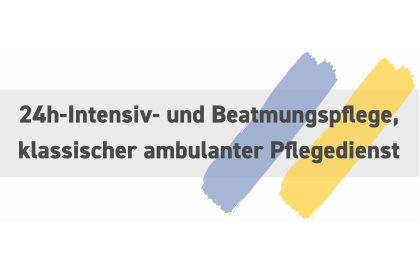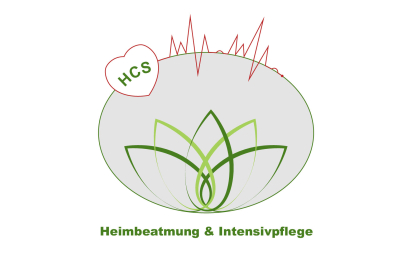„Die Versorgung unterschiedlicher Patienten mit unterschiedlichen Krankheitsbildern ist in der Vielfältigkeit nur in einer Klinik gegeben. Für die Patienten in der häuslichen Versorgung hat die Weiterbildung den Vorteil, dass nun auch andere Methoden und Techniken eingesetzt werden können. Gerade in Bezug auf das Sekret Management sind die hinzugewonnenen Kenntnisse hilfreich, so wird nicht nur standardmäßig der Vibrax genutzt sondern auch neuere Verfahren und Hilfsmittel kommen zum Zuge. Die Weiterbildung führt zur Spezialisierung in dem Bereich und dadurch können eben alle Mitarbeiter profitieren. Bevor ich die Weiterbildung gemacht hatte, wusste ich gar nicht, wie viele unterschiedliche Trachealkanülen es gibt. Dadurch kann für jeden Patienten individuell eine passende Kanüle gefunden werden.“, berichtet Frau Krause.
„Genehmigungen für Hilfsmittel im häuslichen Bereich sind abhängig von der Grunderkrankung. Zum Beispiel erhalten Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen häufig eine Abhusthilfe (wie Cough Assist), bei Patienten mit einer COPD ist es schon schwieriger. Man kann sich aber auch teilweise mit anderen Methoden wie dem Air Stacking behelfen.“
Mit welchen Aufgaben sind Sie primär im außerklinischen Bereich betraut?
„Im außerklinischen Bereich bin ich auf der Basis von 450€ bei der Familien- und Krankenpflege beschäftigt. Die Hauptaufgabe liegt in der Schulung und Anleitung von neuen Mitarbeitern und in der Weiterbildung bereits erfahrener Kolleginnen und Kollegen. Gerade für neue Mitarbeiter ist eine gute und intensive Einarbeitung notwendig. Viele neue Kollegen kommen nicht aus der Intensivpflege und haben wenig bis keine Erfahrung mit Beatmungspatienten. Hier ist es besonders wichtig, dass in der Einarbeitungsphase Sicherheit vermittelt wird. Zunächst liegen häufig Berührungsängste vor, die nur durch ausreichendes Wissen abgebaut werden können. So schule ich im Bereich Trachealkanülen-Management, Pflege und Wechsel von Trachealkanülen. Ebenso weise ich in Beatmungsgeräte ein; dazu gehört das Wechseln der Schläuche, Messen und Anzeigen verschiedener Beatmungsparametern und deren Bedeutung. Welche Alarme deuten auf welche Probleme hin und was sind mögliche Lösungswege. Manchmal werden mir die neuen Mitarbeiter auch in die Klinik zur Hospitation geschickt. Die Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen gehört generell zum Aufgabenbereich der Teamleitungen. Ich leiste hier Unterstützung.“
Frau Krause bespricht aber auch organisatorische Belange mit den Kollegen. „So ist beispielsweise im häuslichen Bereich die Anzahl der Hilfsmittel und Verbrauchsartikel begrenzt. Zu Hause stehen nur 30 HME-Filter zur Verfügung. Das heißt, der Filter muss vor der Inhalation entfernt und nach der Inhalation wieder ans Schlauchsystem angebracht werden. Denn wenn der nass ist, kann man nicht beliebig oft austauschen – man hat ja nur einen Filter pro Tag. In der Klinik ist das Procedere etwas anders und die meisten Mitarbeiter kommen aus der Klinik. Für die häusliche Versorgung muss der Blick auf solche Dinge geschärft werden.“
Was ist das Besondere an der Beatmungssituation zu Hause?
„Die Mitarbeiter zu Hause müssen genau wissen, was bei Problemen zu tun ist und in welchen Fällen der Notarzt gerufen werden muss. Die Pflegekraft muss jederzeit Sicherheit vermitteln, um weder den Patienten noch den Angehörigen unnötigen Stresssituationen auszusetzen. Deshalb sage ich bei der Einarbeitung auch immer, man solle sich den >worst case< vorstellen und gedanklich einmal durchspielen was dann zu tun wäre. So ist man zumindest ein bisschen auf besondere Ereignisse vorbereitet. Wir besprechen Situationen wie beispielsweise Stromausfälle, Gründe für bestimmte Alarme am Beatmungsgerät, die regelmäßige Überprüfung der Geräte – auch das Ersatzgerät gehört dazu. In meiner außerklinischen Zeit habe ich schon so manche Erfahrungen, auch von Notfallsituationen, sammeln können. Diese Erfahrungen gebe ich dann gerne an die Mitarbeiter weiter.“
Wie könnte so eine Notfallsituation zu Hause aussehen auf die man dann entsprechend reagieren muss?
„Ich erinnere mich an einen Fall, das war in der Übergabephase zum Nachtdienst. Ich kam zum Nachtdienst und die Mitarbeiterin vom Spätdienst war noch nicht so lange bei uns. Die Beatmungsmaschine alarmierte auf Grund eines erhöhten Beatmungsdrucks und die Sauerstoffsättigung fiel ab. Die Kollegin wollte bereits den Arzt rufen, da habe ich gesagt: >Wir schauen erst einmal woran es liegen könnte.< Zuerst saugte ich den Patienten ab, die Sättigung stieg langsam wieder an, aber die eigentliche Lösung war es nicht. Der Beatmungsdruck war immer noch erhöht. Wir haben verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen und Änderungen vorgenommen, aber eine sichtliche Besserung trat nicht ein. Zum Schluss haben wir dann festgestellt, dass der HME-Filter nass war und die Luft nicht mehr ungehindert durchtreten konnte. Nach Filteraustausch war das ganze Problem behoben.“
Was ist ihr Tipp für solche Situationen?
„Zunächst einmal Ruhe bewahren und nach und nach alle möglichen Ursachen überprüfen. Häufige Fehlerquellen liegen im Sekret Management, dies ist besonders wichtig. Werden Inhalationen vergessen, wird das Sekret sehr zäh und die Kanüle setzt sich zu. Dann muss die Kanüle ausgewechselt werden. Wer auf viele Erfahrungen zurückgreifen kann, ist oftmals in der Lage einen Klinikaufenthalt zu vermeiden. Denn dieser bedeutet für den Patienten zusätzlicher Stress. Schon alleine die Tatsache, dass der Notarzt zum Transport in die Klinik ein anderes Beatmungsgerät anschließt, ist für den Patienten eine hohe Belastung. Dazu kommt der Transport, der eigentliche Klinikaufenthalt und die Ungewissheit.“
Wie sieht es denn mit Angehörigenschulungen aus – ist ein Bedarf zu erkennen?
„Schulungen von Angehörigen finden häufiger in der Klinik statt, meistens sind es Patienten die mit einer Maske versorgt werden. Hier geht es dann eher um den richtigen Sitz der Maske, das An- und Ausstellen des Beatmungsgerätes, die Versorgung mit Sauerstoff über das Gerät – wo wird der Sauerstoff wieder umgesteckt – und ähnliche Fragen, die von Bedeutung sind. Beatmete Patienten zu Hause haben in aller Regel einen Pflegedienst rund um die Uhr, so dass die Angehörigen die Versorgung nicht übernehmen müssen. Wenn die Krankenkassen nur einen Teil des Tages den Pflegedienst genehmigen, müssen diese Patienten auch nicht 24 Stunden beatmet werden.“
Möchten Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen noch etwas mit auf den Weg geben?
„Mir ist es immer wichtig, dass man auch selbst einmal ausprobiert, wie sich eine Beatmung anfühlt. In meinen Weiterbildungen lasse ich die Teilnehmer immer über eine Maske selbst ausprobieren, was es bedeutet, auf das Beatmungsgerät angewiesen zu sein. Viele haben dann eine andere Meinung zu diesem Thema – die Vorstellung war häufig ganz anders.“
Das war sehr informativ, vielen Dank für das Gespräch.
Exkurs:
Air Stacking: Das bedeutet so viel wie „Luft-stapeln“. Dem Patient werden zum Beispiel mit einem Beatmungsbeutel mehrere Atemhübe hintereinander appliziert – diese Luft wird in der Lunge gespeichert ohne zwischendurch auszuatmen. Hierdurch wird die in der Lunge gesammelte Luftmenge vergrößert und der intrathorakale Druck erhöht. Bei nicht tracheotomierten Patienten kann die Technik über ein Mundstück angewendet werden. Durch den erhöhten intrathorakalen Druck wird annähernd eine Situation geschaffen, die auch bei einem normalen Hustenstoß gegeben ist.