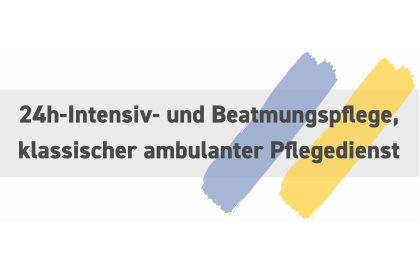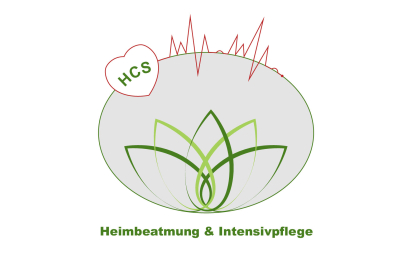Wissenschaftler aus Lübeck (DZL-Standort Airway Research Center North, ARCN) und Marburg (DZL-Standort Universities of Giessen and Marburg Lung Center, UGMLC) haben gemeinsam mit Kollegen aus Graz und Jena eine mikroskopische Methode entwickelt, die es ermöglicht, die Struktur von Atemwegsgewebe und die Kommunikation zwischen Immunzellen im zeitlichen Verlauf direkt im Gewebe sichtbar zu machen. Hierzu machen sie sich eine natürliche Eigenschaft des Körpergewebes zunutze, die sogenannte Autofluoreszenz. Bestrahlt man Zellen oder Gewebestrukturen mit Licht, das eine bestimmte Wellenlänge besitzt, so beginnen sie aufgrund ihrer biochemischen Eigenschaften schwach zu fluoreszieren und werden mikroskopisch beobachtbar. Um Strukturen voneinander zu unterscheiden, kann man Licht unterschiedlicher Wellenlängen verwenden. Nutzt man extrem kurze Infrarotpulse, können Zellen in lebenden Geweben über viele Stunden beobachtet werden. Die so entstehenden Zeitrafferfilme zeigen zum Beispiel, wie Immunzellen miteinander kommunizieren.
In den nun veröffentlichten Untersuchungen wurde dieses Verfahren an den Atemwegen von Mäusen und an noch lebenden Biopsien von menschlichem Lungengewebe angewendet. Ohne zusätzliche Anfärbung konnten verschiedene Zelltypen sowie Gewebsstrukturen sichtbar gemacht werden. Die Wanderung von Immunzellen zu einer experimentell herbeigeführten Gewebsverletzung ließ sich im Zeitverlauf beobachten.
Die Technik bietet weitere faszinierende Möglichkeiten, zu deren Nutzung allerdings noch einige Hindernisse zu überwinden sind. Beispielsweise lassen sich feinere Strukturen wie Zilien – das sind kleine Flimmerhärchen, deren Zustand eine Aussage über verschiedene Erkrankungen ermöglicht – noch nicht darstellen. Außerdem ist die Auflösung im lebenden Körper aufgrund der Bewegung durch Pulsschlag und Atmung noch nicht so gut wie im fixierten explantierten Gewebe. Die Wissenschaftler des ARCN arbeiten intensiv daran, die noch bestehenden Probleme zu lösen.