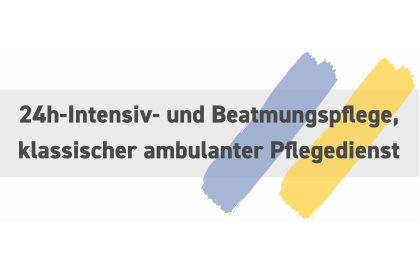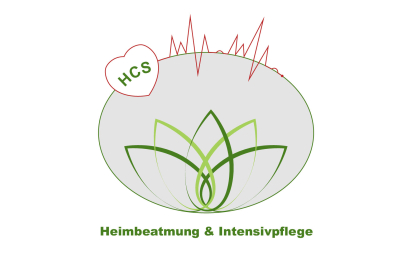Dabei kommt es darauf an, ganz gezielt die Selbstpflegemöglichkeiten der Patienten zu fördern und den entsprechenden Hilfebedarf fortlaufend anzupassen. So werden therapeutische Handlungen aufgrund genauer Beobachtung der Patienten und ihrer Reaktionen geplant. Therapeutisch geschulte Pflegekräfte kommunizieren sowohl verbal als auch nonverbal mit den ihnen anvertrauten Menschen und sind so in der Lage, die Therapien entsprechend anzupassen.
In diesem Rahmen sollen die pflegebedürftigen Menschen die Handlung selbst spüren und dabei so weit einbezogen werden, dass die Aktivitäten des täglichen Lebens trainiert, ihre Fähigkeiten verbessert oder zumindest erhalten werden, um eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Dadurch wird ihre Selbstständigkeit gestärkt und die Patienten geraten nicht in eine oftmals als entmündigend empfundene Abhängigkeit.
Die wichtigsten Bestandteile der aktivierenden Pflege sind spezielle pflegetherapeutische Konzepte wie Bobath, Kinästhetik und basale Stimulation. Zusätzlich kommen das Interaktionsmodell nach Affolter und die Fazio-Orale Therapie (F.O.T.T.) intensiv zum Einsatz.
Basis für die umfassende medizinische und soziale Rehabilitation ist die Arbeit in einem interdisziplinären Team, das aus Pflegenden, Ärzten, Therapeuten und Sozialarbeitern besteht. Die Patienten lernen durch die gezielte Vorgehensweise des Teams, ihre Krankheit zu akzeptieren, sie nach und nach zu überwinden oder Möglichkeiten zum Ausgleich zu entwickeln. Die Rehabilitation beginnt am ersten Behandlungstag, gleichberechtigt neben der akutmedizinischen Versorgung.
Die professionelle Versorgung von Patienten in der außerklinischen Intensivpflege verlangt dem Fachpersonal somit neben medizinischen und pflegewissenschaftlichen Kenntnissen auch Kompetenzen ab, die dazu befähigen, die Pflege als Interaktionsprozess zwischen Pflegenden und Patienten sowie seinen Angehörigen zu verstehen und die Individualität der Patienten in den Mittelpunkt zu stellen.
Weiterbildung zum Fachtherapeuten für außerklinische Intensivpflege und Wachkoma der DGpW
Um Pflegekräfte für diese komplexe Aufgabe besser auszurüsten, hat die Deutsche Gesellschaft für pflegerische Weiterbildung (DGpW) eine Bildungsmaßnahme konzipiert, die sich insbesondere auf die Vermittlung therapeutischer Ansätze in der außerklinischen Intensivpflege konzentriert.
Die 350-stündige Weiterbildung zum Fachtherapeuten für außerklinische Intensivpflege und Wachkoma vermittelt außerdem umfangreiche praxisbezogene Kenntnisse in medizinischen und pflegewissenschaftlichen Disziplinen.
Systemische Beratungsmethoden wirken sich positiv auf die körperliche und seelische Gesundheit aus
Im Rahmen der Weiterbildung setzen sich die Teilnehmer/innen außerdem intensiv mit der systemischen Beratungsmethode auseinander. Der systemische Beratungsansatz, welcher sich auch eng an die systemische Familienmedizin anlehnt, geht von der Annahme aus, dass für den Prozess der Krankheitsbewältigung nicht nur der Klient, sondern das gesamte Familiensystem im Zentrum stehen muss.
Die TeilnehmerInnen lernen mit den etablierten Techniken der systemischen Familientherapie einen kompetenz-, ressourcen- und lösungsorientierten Beratungsprozess zu führen und dabei auf die eigene professionelle Distanz zu achten. Der respektvolle Dialog in der Beratung sowie die Erweiterung von Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten, die sich aus der systemischen Arbeit ergeben, wird als eine elementare Querschnittskompetenz des Fachtherapeuten für die außerklinische Intensivpflege und Wachkomatherapeuten angesehen.
In dem integrativen Ansatz der Deutschen Gesellschaft für pflegerische Weiterbildung werden auf familienzentrierte Pflegemodelle aus dem angloamerikanischen Raum, wie dem Calgary-Modell (Wright & Leahey 2009), und auf Methoden der systemischen Familienmedizin (Altmeyer und Hendrischke 2011) zurückgegriffen. Studien zeigen, dass die Einbeziehung von Familienangehörigen in den Versorgungsprozess einen signifikant positiven Effekt auf die körperliche und seelische Gesundheit sowohl der Patienten als auch der Familienangehörigen haben kann, wie in einer groß angelegten Metaanalyse (Hartmann et al. 2010) von 52 Studien, in die fast 9000 Patienten einbezogen waren, bestätigt werden konnte.
Zusammengefasst erlangen die Absolventen/innen der Weiterbildung zum Fachtherapeuten für die außerklinische Intensivpflege und Wachkoma folgende Spezialisierungen:
• Strategien zur Recherche und Implementierung von „evidence-based practice“ in Bezug auf berufsspezifische Assessment-, Diagnose-, Therapie-, Pflege- und Betreuungsprozesse in der Arbeit mit Wachkomapatienten
• Systemische Beratungsmethoden der Familienzentrierten Pflege (Family Nursing) und systemischen Familienmedizin
• Systemisch-familientherapeutische Methoden der Angehörigen- und Biographiearbeit
• Pflegetherapeutisches Arbeiten nach dem
– Affolter-Modell
– dem Bobath-Konzept
– F.O.T.T.
– Resilienzberatung
• Implementierte Grundkurse: Basale Stimulation und Kinesthätik (Maietta-Hatch Kinaesthetics)
*Die beziehungsmedizinische Sicht auf den Patienten
Die klassische medizinische Sicht stellt die beobachtbaren neurologischen Ausfallserscheinungen in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung. Verhaltensde¬fizite der Person wie fehlende Reaktionsfähigkeit und fehlende Weckbar¬keit auf bestimmte Reize geben Aufschluss über die Schwere der dahinter stehenden Bewusstseinsstörung. Insofern werden die Unfähigkeit zur sinnvollen Reaktion auf Ansprache oder Berührung und das Unvermögen zur Kontaktaufnahme mit der Umwelt als hauptsächliche Definitions¬kriterien des Wachkomas gesehen (Bienstein und Hannich 2000, S. 11).
Neben dieser Position steht die sogenannte beziehungsmedizinische Sicht. Diese versucht, den Zustand des Patienten nicht primär durch seine Defizite zu beschreiben. Sie bemüht sich stattdessen um die Betrachtung des Kranken unter Einbezug von Beobachtungen und Erfahrungen der Betreuer, unter Betonung der individuellen Biographie sowie der Möglich¬keit zu einem subjektiven Erleben. Fehlende Reaktionsfähigkeit und Weckbarkeit werden nicht mit Wahrnehmungs- und Empfindungs-unfähigkeit gleichgesetzt (Bienstein und Hannich 2000, S. 11ff.).
Nähere Informationen zur Fachweiterbildung, die am 27.10. in Traunstein im Chiemgau startet, gibt es bei der DGpW:
Deutsche Gesellschaft für pflegerische Weiterbildung
Telefon 0 86 62/48 59 38, www.dg-pw.de