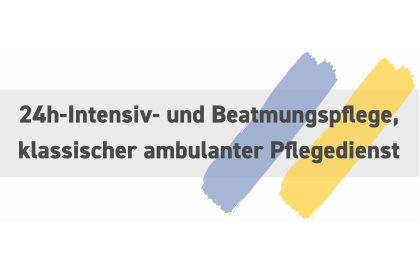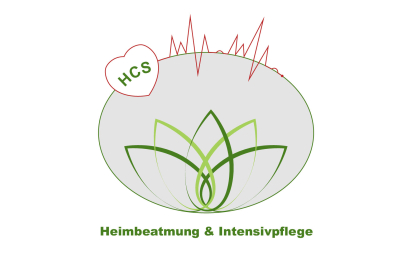Die Patienten, die auf die Spezialstation ins St. Elisabeth-Krankenhaus verlegt werden, kommen aus den umliegenden Krankenhäusern und in jüngster Zeit auch aus dem Universitätsklinikum Münster. In der Regel liegen bereits mehrere missglückte Weaning-Versuche hinter ihnen. Doch es gibt neue Konzepte, wie man eine kontrollierte Entwöhnung von der Maschine auch bei schwer kranken Menschen erfolgreich durchführt. „Heute können viele Patienten von einer Langzeitbeatmung entwöhnt werden. Damit wird viel für Lebensqualität und Prognose erreicht“, erläutert Thomas.
Erste Voraussetzung für ein erfolgreiches Weaning ist in der Regel die Anlage einer Trachealkanüle. Dabei schafft man durch einen kleinen Einschnitt in Hals und Luftröhre einen künstlichen Luftweg, in den eine Kanüle eingelegt wird. Sie löst die Beatmung durch den Tubus ab. „Erst dank einer Trachealkanüle haben wir die Möglichkeit, die Patienten wach werden und sie wieder phasenweise spontan atmen zu lassen“, so Holtbecker. Ist der Patient nach der Zeit der Eigenatmung erschöpft und benötigt künstliche Unterstützung, dann wird das Beatmungsgerät wieder an die Trachealkanüle angeschlossen. Das Team der Weaning-Station versucht nun, die Phasen, in denen der Patient spontan atmet, kontinuierlich auszudehnen. Anfangs sind es vielleicht nur fünfzehn Minuten, in denen der Patient selbständig Luft schöpft; nach einigen Tagen vielleicht schon mehrere Stunden. Während der ganzen Zeit werden in der Überwachungseinheit Lungenfunktion, Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung des Blutes und Abatmung des Kohlendioxids überprüft.
Das Weaning ist zwar für die Menschen körperlich sehr anstrengend, aber dennoch auch eine Phase voller Hoffnung und Zuversicht. „Die Patienten blühen richtig auf, wenn die Zeitspannen, in denen sie noch eine künstliche Beatmung benötigen, immer weiter verkürzt werden“, berichtet Holtbecker. Bei manchen ist das Weaning bereits nach wenigen Tagen abgeschlossen; bei wieder anderen, die unter schweren Grunderkrankungen leiden, kann die Entwöhnung aber auch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Deshalb legt das Team im St. Elisabeth-Krankenhaus großen Wert auf ein angenehmes Ambiente und eine persönliche Atmosphäre. „Wir machen fast alles möglich, was den Patienten gut tut“, versichert Thomas. Eine wichtige Rolle im Genesungsprozess spielen die Angehörigen. „Starre Besuchszeiten gibt es bei uns nicht. Und wenn Familienmitglieder von weit her kommen, um ihre Angehörigen zu besuchen, kümmern wir uns auch um eine Übernachtungsmöglichkeit“, sagen die beiden Chefärzte.
Viel Kompetenz, Erfahrung und Sensibilität sind nötig, damit der Weg zurück ins Leben erfolgreich ist. Doch in den meisten Fällen gelingt er. Und die Patienten danken für dieses Engagement mit der höchsten Währung, die ihnen zur Verfügung steht: ihrem Vertrauen.
Klinik für Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin
Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Str. 1
46282 Dorsten
Telefon: 02362 29-55203
www.kkrn.de
E-Mail: pneumologie.dorsten@kkrn.deLeitung:
Dr. Norbert Holtbecker, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Allergologie, Umweltmedizin, Schlafmedizin und medikamentöse Tumortherapie.
Dr. Hermann Thomas, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Allergologie, Umweltmedizin, Schlafmedizin, Sportmedizin, Infektiologie und medikamentöse Tumortherapie.
Betten: 50
Team: 10 Ärzte