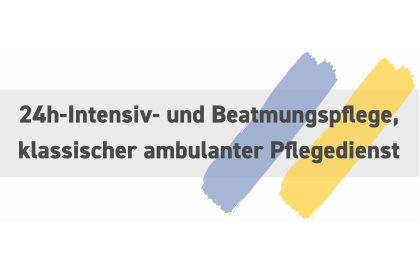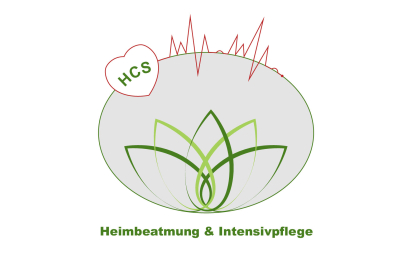Die Zuständigkeit
Die Sozialgerichtsbarkeit ist zum Beispiel zuständig für Streitigkeiten über Leistungsansprüche der Versicherten. Das betrifft unter anderem Entscheidungen:
• der Krankenkasse über beantragte Hilfsmittel;
• der Pflegekasse über Leistungen aus der Pflegeversicherung;
• der Berufsgenossenschaft über die Anerkennung eines Arbeitsunfall;
• der Agentur für Arbeit über Arbeitslosengeld;
• der Arbeitsgemeinschaft beziehungsweise Gemeinde über Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe;
• der Rentenversicherungsanstalt über die Rente;
• des Versorgungsamtes über den Grad einer Behinderung und Zuerkennung von Merkzeichen.
Das Widerspruchsverfahren
Vorher ist allerdings das Widerspruchsverfahren durchzuführen. Wer eine ablehnende Entscheidung des Leistungsträgers, beispielsweise Kranken- oder Pflegekasse, Berufsgenossenschaft, Versorgungsamt etc. erhält, kann zunächst versuchen, mit einem informativen Gespräch bei der Behörde weiterzukommen. Vielleicht lag der Ablehnung nur ein Missverständnis zu Grunde, dass schon im Gespräch ausgeräumt werden kann. Kommt man damit nicht weiter, sollte Widerspruch gegen die Ablehnung der beantragten Leistung eingelegt werden.
Wichtig ist, dass der Widerspruch an eine Frist von einem Monat ab Bekanntgabe des Bescheides gebunden ist.
Damit diese Frist nicht versäumt wird, empfiehlt es sich, zunächst nur Widerspruch einzulegen und eine Begründung zu einem späteren Zeitpunkt anzukündigen. So kann beispielweise formuliert werden
“Gegen die Entscheidung vom …….. lege ich Widerspruch ein. Ich bin der Ansicht, dass mir …………. doch zusteht. Die Begründung werde ich nachreichen. Ich bitte um Eingangsbestätigung.”
Damit wird erreicht, dass sich die Behörde noch einmal mit dem Anliegen des Bür-gers befasst. Der Widerspruch kostet nichts und ist auch ohne jedes Risiko. Für die Begründung können z. B. weitere medizinische Befundberichte vorgelegt werden, die den Anspruch untermauern. Um überzeugend begründen zu können, empfiehlt es sich, auch sachkundige Beratung, etwa durch einen Sozialverband, Selbsthilfegruppe oder Anwalt in Anspruch zu nehmen. Das Anliegen wird von der Behörde noch einmal geprüft. Tut sie das nicht ausreichend, kann bei Klageerhebung das Gericht die Behörde verpflichten, das nachzuholen.
Ist die Behörde nach erneuter Prüfung der Ansicht, dass der Anspruch tatsächlich bestand, hilft sie dem Widerspruch ab. Das bedeutet, dass sie die beantragte Leis-tung gewährt. Überzeugt die Behörde auch bei nochmaliger Prüfung und weiterer Begründung die Argumentation nicht, wird sie den Widerspruch zurückweisen. Das Verfahren ist durch Erlass des Widerspruchsbescheides dann abgeschlossen.
Die Klageerhebung
Jetzt kann nur noch Klage erhoben werden. Die Klage muss innerhalb der Frist von einem Monat ab Bekanntgabe des Bescheides beim Sozialgericht eingegangen sein. Man kann sie selbst führen. Es reicht zunächst ein formloses Schreiben an das Gericht. Am Ende des Widerspruchsbescheides steht, wo die Klage zu erheben ist und welche Adresse das Gericht hat. Das Schreiben kann sinngemäß lauten:
“Gegen den Bescheid ……….. vom ………… und den Widerspruchsbe-scheid vom …………….., mit dem mein Antrag abgelehnt wurde, erhe-be ich Klage. Ich meine, dass mir der Anspruch zusteht und bitte, den/die ………………………… entsprechend zu verurteilen. Eine weitere Begründung werde ich nachreichen.”
Die Sozialgerichte haben auch eine Rechtsantragstellung. Sie gibt Hilfe bei der For-mulierung und Begründung der Klage. Die Prozessführung kann durch einen Rechtsanwalt oder zugelassenen Rechtsbeistand, Gewerkschaften oder sozial- oder berufspolitische Verbände erfolgen.
Das Gericht bestätigt den Eingang der Klage und gibt der Klageschrift ein Aktenzei-chen, unter dem der Vorgang geführt wird. Alles Weitere veranlasst dann das Ge-richt.
Das Gericht ist nach dem Gesetz zur Aufklärung des Sachverhalts verpflichtet. Natürlich kann das nicht ohne Mithilfe der Beteiligten geschehen.
So wird zu Anfang eines Klageverfahrens in der Regel ein Fragebogen verschickt, mit dem der Kläger gebeten wird, Angaben zu den behandelnden Ärzten zu machen und sie von der Schweigepflicht zu entbinden. Dann kann das Gericht dort Befundberichte anfordern, und sich so ein Bild darüber machen, ob der Anspruch zusteht oder nicht.
Werden Befundberichte eingeholt und sind sie nicht aussagekräftig, kann das Gericht ein Sachverständigengutachten in Auftrag geben. Ein solches Gutachten wird durch neutrale, bei Gericht bekannte Ärzte oder Pflegefachkräfte erstellt. War das Gutachten für den Kläger nicht positiv, kann er bei Gericht beantragen, dass ein Gutachten von einem Arzt seines Vertrauens eingeholt wird.
Hat das Gericht den Sachverhalt ausreichend ermittelt, kann es einen Termin zur Erörterung des Sachverhaltes (Erörterungstermin) ansetzen. Er kann kombiniert werden mit einer Beweisaufnahme, etwa der Vernehmung von Zeugen zu einem bestimmten Thema. In einem Erörterungstermin legt das Gericht die Erfolgsaussichten der Klage dar. Die Beteiligten haben die Möglichkeit, in diesem Termin die Sache ausführlich zu besprechen. Danach kann der Anspruch von der Gegenseite anerkannt oder die Klage vom Kläger zurückgenommen werden. In der Regel endet ein Erörterungstermin aber mit dem Abschluss eines einvernehmli-chen Vergleichs.
Eine andere Möglichkeit zur Beendigung des Verfahrens ist der Erlass eines Ge-richtsbescheides. Dieser Weg wird gewählt, wenn kein Erörterungsbedarf besteht, der Sachverhalt geklärt ist und auch keine rechtlich problematischen Fragen anste-hen.
Endet das Verfahren weder durch Erörterungstermin noch auf schriftlichem Weg, lädt das Gericht zu einem Verhandlungstermin.
In der Verhandlung sind ein Berufsrichter und zwei Laienrichtern anwesend. Die Laienrichter sind ehrenamtliche Richter, die unter anderem aus dem Kreis der Versicherten, der Versorgungsberechtigten und der Arbeitgeber stammen. Sie üben das Amt mit genau den Rechten aus, wie sie auch der Berufsrichter hat. Der Berufsrichter und die ehrenamtlichen Richter entscheiden unabhängig nach Recht und Gesetz. Sie sind weisungsungebunden und zur Unparteilichkeit verpflichtet. Am Ende der Verhandlung ergeht ein Urteil.
Ebenso wie der Ablehnungsbescheid und der Widerspruchsbescheid, ist auch das Urteil mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen. Aus ihr ergibt sich, ob gegen die Entscheidung des Gerichts vorgegangen werden kann und wenn ja innerhalb wel-cher Frist und bei welcher Stelle das geschehen muss.
Die Kosten
Wer als Versicherter, Leistungsempfänger oder behinderter Mensch am Verfahren beteiligt ist, muss vor dem Sozialgericht keine Gerichtskosten zahlen. Wer im Pro-zess unterliegt, muss auch nur seine eigenen Kosten zahlen, falls er sich einen Rechtsbeistand auserwählt hat. Wer weder rechtsschutzversichert ist, noch über die finanziellen Mittel verfügt, einen Anwalt selber zu bezahlen, kann Prozesskostenhilfe beantragen.
Verfasst von:
Rechtsanwältin Anja Bollmann
Jakobstraße 113
51465 Bergisch Gladbach
www.Anja-Bollmann.de
Tel.: 02202/29 30 60
Fax: 02202/29 30 66
Stand: 02.04.2014